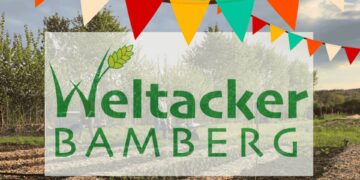Smartphones, Laptops und Tablets sind längst fester Bestandteil unseres Alltags. Ob wir shoppen, spielen oder Videos ansehen – das Internet bietet unzählige Möglichkeiten der Unterhaltung und Information.
Doch was passiert, wenn die Nutzung digitaler Angebote zur Gewohnheit wird, die wir kaum noch steuern können? Immer mehr Menschen fragen sich: Habe ich meine Internetnutzung noch im Griff? Genau dieser Frage geht die Forschungsgruppe ‚Affective and cognitive mechanisms of specific Internet-use disorders‘ (ACSID) nach. Seit 2020 untersucht das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projektteam die psychologischen und neurobiologischen Prozesse hinter Internetbezogenen Störungen – etwa bei exzessivem Computerspielen, Online-Shopping oder dem Konsum von Pornografie.
Acht Universitäten, ein Ziel: Internet-Sucht besser verstehen
Das Projekt ist eine Kooperation zwischen acht deutschen Universitäten unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Brand von der Universität Duisburg-Essen. Auch die Universität Bamberg ist beteiligt – hier forscht das Team um Prof. Dr. Sabine Steins-Löber an klinisch-psychologischen Aspekten der Internetnutzung. Ziel der Gruppe ist es, die Mechanismen hinter digitalen Suchterkrankungen besser zu erfassen. Die Erkenntnisse sollen helfen, effektive Hilfsangebote zu entwickeln und langfristig Menschen zu unterstützen, deren Alltag durch ihre Online-Gewohnheiten beeinträchtigt wird.
Jetzt mitmachen: Teilnehmende für neue Studien gesucht
Aktuell starten zehn neue Teilprojekte im Rahmen von ACSID – und dafür werden Probandinnen und Probanden gesucht. Die Studien richten sich an Erwachsene ab 18 Jahren mit guten Deutschkenntnissen. Die Teilnahme erfolgt entweder vor Ort an einem der Projektstandorte oder bequem online. Je nach Studie stehen unterschiedliche Aufgaben an: vom Ausfüllen von Fragebögen über neuropsychologische Tests bis hin zu ausführlichen Video-Interviews. Die Aufwandsentschädigung liegt bei 12 Euro pro Stunde, was zusätzlich zur wissenschaftlichen Relevanz einen weiteren Anreiz bietet.
Besonders gefragt: Frauen mit digitalen Nutzungsmustern
Eine der Studien beschäftigt sich gezielt mit Geschlechterunterschieden bei Computerspielstörungen und Pornografienutzung. Hier wird untersucht, welche psychologischen Prozesse die Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Störungen beeinflussen. Besonders herausfordernd ist es, Frauen zur Teilnahme an der Studie zu ermutigen. Frauen, die häufig zocken oder Pornografie konsumieren und dabei möglicherweise negative Auswirkungen auf ihr Leben bemerken, sind eine bisher stark unterrepräsentierte Zielgruppe. Ihre Erfahrungen sind jedoch für die Forschung essenziell, um ein vollständiges Bild der Problematik zu erhalten. Zur Teilnahme und weiteren Informationen: www.uni-bamberg.de/klinpsych/forschung/projekte/geschlechtsspezifische-aspekte-bei-der-computerspielstoerung-und-der-pornografienutzungsstoerung
Der Reiz des Digitalen: Wenn Belohnungssysteme entgleisen
Ein weiteres Teilprojekt beschäftigt sich mit der Wirkung sogenannter suchtrelevanter Reize. Diese Reize – etwa visuelle Elemente in Computerspielen oder Online-Shops – können das Verhalten von Menschen nachhaltig beeinflussen, selbst wenn keine tatsächliche Belohnung mehr erfolgt. Hierfür suchen die Forschenden Personen, die regelmäßig Computerspiele spielen oder Online-Shopping betreiben. Die Studie untersucht unter anderem die Frage, wie stark das Belohnungssystem des Gehirns auf digitale Reize reagiert – und welche psychischen Faktoren das verstärken oder abschwächen. Mehr zur Studie unter: www.uni-bamberg.de/klinpsych/forschung/projekte/internetnutzungsstoerungen/reduktion-des-belohnungswerts-bei-computerspielstoerung-und-kauf-shoppingstoerung
Warum diese Forschung wichtig ist
Internetsucht wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile als ernstzunehmende psychische Störung anerkannt. Dennoch fehlt es vielerorts an geeigneten Behandlungsangeboten. Die Arbeiten der Forschungsgruppe ACSID könnten diesen Zustand nachhaltig verbessern. „Mit unseren Untersuchungen wollen wir erreichen, die psychologischen Mechanismen hinter Internet-Suchterkrankungen besser zu verstehen“, so Prof. Steins-Löber. „Langfristig möchten wir dazu beitragen, dass Menschen mit Suchterkrankungen wirksame Strategien an die Hand gegeben werden können, um Herausforderungen zu bewältigen und ein erfülltes Leben zu führen.“
Ein erster Schritt: Selbsterkenntnis und Reflexion
Nicht jeder, der viel Zeit online verbringt, ist gleich suchtgefährdet. Entscheidend ist, ob das Verhalten negative Konsequenzen hat – etwa in Form von sozialem Rückzug, Leistungsabfall oder Kontrollverlust. Genau hier setzen die Studien an: Sie helfen Betroffenen, das eigene Verhalten besser zu verstehen, und ermöglichen gleichzeitig wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse. Wer sich angesprochen fühlt, kann mit der Teilnahme an einer der Studien nicht nur einen persönlichen Einblick gewinnen, sondern auch aktiv zur Verbesserung künftiger Unterstützungsangebote beitragen.